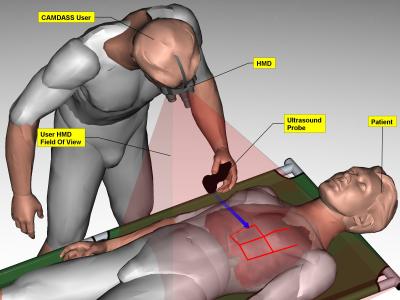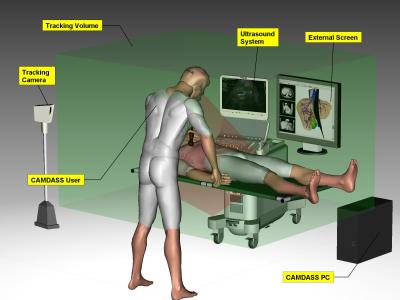Neue Generation von Luftschiffen: Elefanten der Lüfte
In der aktuell erschienen Ausgabe der SKY Revue (www.skyrevue.at) wird über neue Luftschiff-Projekte berichtet.
Gemeinsam ist allen Projekten, dass sie sich nicht als Ersatz für Transportflugzeuge positionieren, sondern eher als Alternative zu Schiffen, die treibstoffsparend auch Binnengebiete befahren können.
Derzeit beeindruckt vor allem der Airlander von Hybrid Air Vehicles die Enthusiasten und amüsiert den Zuseher, denn die Form der Doppelrumpf-Hülle erinnert von vorne an einen knackigen Po. In zwei Größen bastelt der britische Hersteller an einer Auferstehung der Gas-Giganten. Dabei ist der kleinere Airlander 10 mit 92 Metern Länge (das sind zwölf Meter mehr als ein A380) und einer Tragkraft von zehn Tonnen auch schon ganz schön groß.

Im Auftrag der US Army bastelte Hybrid Air Vehicles in Zusammenarbeit mit Northrop Grumman von 2010 bis 2013 am LEMV, einem militärischen Luftschiff, das für Aufklärungsflüge in Afghanistan eingesetzt werden sollte. Das Projekt scheiterte letztlich an Sicherheitsbedenken und seinem unpräzisen Zeitplan. Die zivile Wiedererweckung gelang mittels Crowdfunding, bei dem unter anderem der flugbegeisterte Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson – er pilotiert auch die Band-eigenen 747 auf Tour - für marktgerechte PR sorgte. Wenn der “Kleine” erst einmal fliegt, will man bei Airlander erst recht hoch hinaus - mit einer 119 Meter langen Version, deren Tragkraft über 50 Tonnen bewegen kann. Als Lasttransporter eignen sich die Luftschiffe der neuesten Generation natürlich vor allem dort, wo eine dauerhafte Infrastruktur fehlt.
Auch in den USA hat man den Traum der wirtschaftlich nicht leichten Fliegerei noch nicht aufgegeben. Das Luftschiff von Lockheed Martin wird als Kreuzung aus Luftschiff, Flugzeug, Helikopter und Hovercraft beschrieben. Der optisch auffälligste Unterschied zu bisherigen Projekten sind die runden Lande-Luftpolster, die Landungen auf jedem Untergrund ohne weitere Vorbereitungen ermöglichen sollen. Nach der Landung saugen sich die Füße am Untergrund fest und garantieren einen festen Stand. Mit 21 Tonnen Tragkapazität bei 160 Kubikmetern Ladevolumen und zusätzlichem Platz für 19 Passagiere ist der Luft-Lastesel P-791 für alle Einsätze gerüstet und hat einen Vorteil gegenüber seinen britischen Kollegen: Er fliegt bereits, und das seit 2006. Mit 60 Knoten Geschwindigkeit ist er dabei deutlich schneller, als die bullige Form vermuten ließe.
Dass die Wiederauferstehung der fliegenden Legenden nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist, hat man in Süddeutschland bereits bewiesen. Der Zeppelin NT, Nachfolger des Urgesteins der Luftschifffahrt, ist seit den 90er-Jahren unterwegs. Zwar sind die markanten Silhouetten vor allem für publikumswirksame Panoramaflüge bekannt, doch der verjüngte Zeppelin konnte sich auch in Diamantensucheinsätzen in Südafrika und Botswana beweisen. Technologisch beeindruckte die Friedrichshafener Luftschiffwerft in ihren Luftschiffen mit einer Kombination aus alt und neu, denn im Cockpit der traditionsbewussten Zeppeline steckt reichlich High Tech, die unter anderem das Fly-By-Wire-System aus dem Hause Airbus einsetzt.
Beim kalifornischen Hersteller Aeros wurde der Prototyp Dragon Dream zwar kurz nach den ersten Schwebestests 2013 durch einen Halleneinsturz zerstört, doch es geht weiter. Der kleinste aus der dort geplanten Flotte, der ML866 mit 66 Tonnen Tragkraft bei 170 Meter Länge, soll bereits im nächsten Jahr seinen Erstflug absolvieren. Größere Modelle bis hin zu 500 Tonnen Tragkraft sollen folgen.
Auch ein russischen Gigant ist gestartet: RoseAercoSystems baut Luftschiffe bereits seit 1991, doch der derzeit im Test befindliche Atlant bringt ganz neue Features mit. Mit seiner Carbon-Hülle wird er gegen besonders widrige Wetterbedingungen gewappnet sein, die vertikale Manövrierfähigkeit wird durch ein neues System des Ein- und Abpumpens von Außenluft verbessert, das für die nötige Lande-Schwere und Start-Leichtigkeit sorgt. In zwei Größen, mit 30 und 60 Tonnen Kapazität, soll der Atlant bereits 2018 für das russische Militär zur Verfügung stehen.
Die SKY Revue wird von #Gassner&Hluma Communications www.gh-pr.at produziert.
Gemeinsam ist allen Projekten, dass sie sich nicht als Ersatz für Transportflugzeuge positionieren, sondern eher als Alternative zu Schiffen, die treibstoffsparend auch Binnengebiete befahren können.
Derzeit beeindruckt vor allem der Airlander von Hybrid Air Vehicles die Enthusiasten und amüsiert den Zuseher, denn die Form der Doppelrumpf-Hülle erinnert von vorne an einen knackigen Po. In zwei Größen bastelt der britische Hersteller an einer Auferstehung der Gas-Giganten. Dabei ist der kleinere Airlander 10 mit 92 Metern Länge (das sind zwölf Meter mehr als ein A380) und einer Tragkraft von zehn Tonnen auch schon ganz schön groß.

Im Auftrag der US Army bastelte Hybrid Air Vehicles in Zusammenarbeit mit Northrop Grumman von 2010 bis 2013 am LEMV, einem militärischen Luftschiff, das für Aufklärungsflüge in Afghanistan eingesetzt werden sollte. Das Projekt scheiterte letztlich an Sicherheitsbedenken und seinem unpräzisen Zeitplan. Die zivile Wiedererweckung gelang mittels Crowdfunding, bei dem unter anderem der flugbegeisterte Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson – er pilotiert auch die Band-eigenen 747 auf Tour - für marktgerechte PR sorgte. Wenn der “Kleine” erst einmal fliegt, will man bei Airlander erst recht hoch hinaus - mit einer 119 Meter langen Version, deren Tragkraft über 50 Tonnen bewegen kann. Als Lasttransporter eignen sich die Luftschiffe der neuesten Generation natürlich vor allem dort, wo eine dauerhafte Infrastruktur fehlt.
Auch in den USA hat man den Traum der wirtschaftlich nicht leichten Fliegerei noch nicht aufgegeben. Das Luftschiff von Lockheed Martin wird als Kreuzung aus Luftschiff, Flugzeug, Helikopter und Hovercraft beschrieben. Der optisch auffälligste Unterschied zu bisherigen Projekten sind die runden Lande-Luftpolster, die Landungen auf jedem Untergrund ohne weitere Vorbereitungen ermöglichen sollen. Nach der Landung saugen sich die Füße am Untergrund fest und garantieren einen festen Stand. Mit 21 Tonnen Tragkapazität bei 160 Kubikmetern Ladevolumen und zusätzlichem Platz für 19 Passagiere ist der Luft-Lastesel P-791 für alle Einsätze gerüstet und hat einen Vorteil gegenüber seinen britischen Kollegen: Er fliegt bereits, und das seit 2006. Mit 60 Knoten Geschwindigkeit ist er dabei deutlich schneller, als die bullige Form vermuten ließe.
Dass die Wiederauferstehung der fliegenden Legenden nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist, hat man in Süddeutschland bereits bewiesen. Der Zeppelin NT, Nachfolger des Urgesteins der Luftschifffahrt, ist seit den 90er-Jahren unterwegs. Zwar sind die markanten Silhouetten vor allem für publikumswirksame Panoramaflüge bekannt, doch der verjüngte Zeppelin konnte sich auch in Diamantensucheinsätzen in Südafrika und Botswana beweisen. Technologisch beeindruckte die Friedrichshafener Luftschiffwerft in ihren Luftschiffen mit einer Kombination aus alt und neu, denn im Cockpit der traditionsbewussten Zeppeline steckt reichlich High Tech, die unter anderem das Fly-By-Wire-System aus dem Hause Airbus einsetzt.
Beim kalifornischen Hersteller Aeros wurde der Prototyp Dragon Dream zwar kurz nach den ersten Schwebestests 2013 durch einen Halleneinsturz zerstört, doch es geht weiter. Der kleinste aus der dort geplanten Flotte, der ML866 mit 66 Tonnen Tragkraft bei 170 Meter Länge, soll bereits im nächsten Jahr seinen Erstflug absolvieren. Größere Modelle bis hin zu 500 Tonnen Tragkraft sollen folgen.
Auch ein russischen Gigant ist gestartet: RoseAercoSystems baut Luftschiffe bereits seit 1991, doch der derzeit im Test befindliche Atlant bringt ganz neue Features mit. Mit seiner Carbon-Hülle wird er gegen besonders widrige Wetterbedingungen gewappnet sein, die vertikale Manövrierfähigkeit wird durch ein neues System des Ein- und Abpumpens von Außenluft verbessert, das für die nötige Lande-Schwere und Start-Leichtigkeit sorgt. In zwei Größen, mit 30 und 60 Tonnen Kapazität, soll der Atlant bereits 2018 für das russische Militär zur Verfügung stehen.
Die SKY Revue wird von #Gassner&Hluma Communications www.gh-pr.at produziert.
hlumamanfred - 14. Jul, 11:39