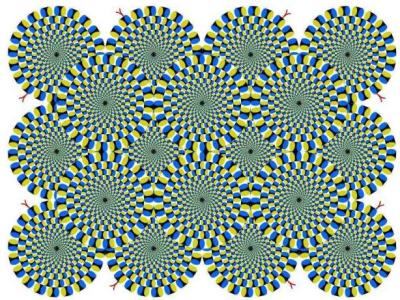Digitale Fussfesseln oder „Killt cc“ (2): Von menschlichen Firewalls
Der Pferdefuss der modernen Kommunikationstechnik ist, dass die Menschen immer mehr unter dem Zugzwang stehen, den ständige Erreichbarkeit mit sich bringt. Es bedeutet, auf Informationen immer schneller reagieren zu müssen.
Erwartete man bei einem Brief die Antwort erst in einigen Tagen, sind es beim e-mail nur noch ein paar Stunden und bei SMS erwarten viele Sender die prompte Reaktion des Empfängers.
US-Forscher haben 1000 Wissensarbeiter intensiv über ihre Arbeitsabläufe befragt: Die Untersuchung ergab, dass die Büromenschen im Schnitt 2,1 Stunden am Tag verbummelten, weil sie abgelenkt waren.
Eine andere, detailliertere Untersuchung zeigte: Elf Minuten konnten sich die Wissensarbeiter im Schnitt mit einer Aufgabe beschäftigen, bevor ihre Aufmerksamkeit durch einen Anruf, eine Mail, eine SMS oder einen anklopfenden Kollegen zwangsweise einem anderen Thema zugeführt wurde. Dann dauerte es durchschnittlich 25 Minuten, bevor sie sich wieder der alten Aufgabe widmen konnten. Die Gedanken erneut zu sammeln dauerte im Schnitt acht Minuten. Unter dem Strich heißt das: drei Minuten bis zur nächsten Unterbrechung. Das bringt eine ziemliche Ineffizienz.
Eine weitere wesentliche Erkenntnis: In dieser 25minütigen Ablenkungsphase kommen in 40 Prozent aller Fälle neue Aufgaben hinzu, die so wichtig erscheinen, dass die alte vollkommen in Vergessenheit gerät oder die Mitarbeiter sie zumindest auf unbestimmte Zeit verschieben. Unter diesen Voraussetzungen jonglierten die Testpersonen durchschnittlich mit zwölf verschiedenen Projekten gleichzeitig, die sie in ihrem zerstückelten Arbeitsalltag zu erledigen hatten.
Eine Führungskraft in einem Konzern bekommt heute zwischen 150 und 200 E-Mails am Tag - Spam nicht mitgerechnet. Um das seriös durchzuarbeiten, braucht sie mindestens zwei Stunden.
Eine der Ursachen findet sich in dem modischen Brauch, jeden Kollegen, Mitarbeiter oder Kunden auf jeden denkbaren E-Mail-Verteiler zu setzen. Als man Informationen noch kopieren und dann per Hauspost verteilen musste, wurde automatisch genau überlegt, wer denn die Information wirklich braucht. Heute ist es ein Klick des Absenders, und die ganze Firma wird zugeschüttet...
Denn der gerade der inflationäre „CC“-Gebrauch sorgt dafür, dass Informationen oft auch diejenigen nicht mehr erreichen, für die sie tatsächlich relevant sind. Denn die ertrinken gerade in den für sie unnötigen hunderten "Zur Info"-Mails.
Mehr Kommunikation bedeutet leider auch mehr Aufgaben aufgeladen zu bekommen, die noch dazu schnell erledigt werden sollen. Den Rationalisierungsmaßnahmen sind unter anderem die Einsparung von Sekretariaten mit sich gebracht. Dadurch sind bei wachsender Informationsflut sind die menschlichen Filter weggefallen, die früher für Führungskräfte Informationen vorsortiert haben.
Es ist also hoch an der Zeit, sich geschützt Räume und Zeiten zu schaffen.
Eine Maßnahme kann sein, die geschäftliche Kommunikation von der Bring- wieder zur Holschuld zu machen. Konkret sollen Informationen lieber systematisch und gut auffindbar im Intranet oder in internen Datenbanken abgelegt werden als in den elektronischen Rundlauf zu gehen.
Eine andere Maßnahme ist es, die Absender zu erziehen, nicht mehr alles auf „cc“ zu setzen. „Killt cc“ raten manche Unternehmensberater.
Wie man mit der elektronischen Kommunikation sinnvoll umgeht, dafür gibt es bisher keine wirklichen Spielregeln. Ein Versuch eines Unternehmen läuft daraus hinauf, die E-Mail-Kommunikation stark zu hierarchisieren. Mails sollen nur noch an den jeweils direkten Vorgesetzten geschickt werden können, aber nicht mehr weiter hinauf.
Andere Betriebsberater empfehlen, die e-mails nur noch zweimal am Tag zu bearbeiten. Und ein deutscher Uni-Professor hat sich eine andere Methode zulegt, um Fehler durch die geforderte Schnelligkeit zu minimieren: Er beantwortete alle Anfragen, die größere Budgetposten betreffen, erst einen Tag später, um wenigstens eine Nacht darüber schlafen zu können.
Manfred Hluma
Erwartete man bei einem Brief die Antwort erst in einigen Tagen, sind es beim e-mail nur noch ein paar Stunden und bei SMS erwarten viele Sender die prompte Reaktion des Empfängers.
US-Forscher haben 1000 Wissensarbeiter intensiv über ihre Arbeitsabläufe befragt: Die Untersuchung ergab, dass die Büromenschen im Schnitt 2,1 Stunden am Tag verbummelten, weil sie abgelenkt waren.
Eine andere, detailliertere Untersuchung zeigte: Elf Minuten konnten sich die Wissensarbeiter im Schnitt mit einer Aufgabe beschäftigen, bevor ihre Aufmerksamkeit durch einen Anruf, eine Mail, eine SMS oder einen anklopfenden Kollegen zwangsweise einem anderen Thema zugeführt wurde. Dann dauerte es durchschnittlich 25 Minuten, bevor sie sich wieder der alten Aufgabe widmen konnten. Die Gedanken erneut zu sammeln dauerte im Schnitt acht Minuten. Unter dem Strich heißt das: drei Minuten bis zur nächsten Unterbrechung. Das bringt eine ziemliche Ineffizienz.
Eine weitere wesentliche Erkenntnis: In dieser 25minütigen Ablenkungsphase kommen in 40 Prozent aller Fälle neue Aufgaben hinzu, die so wichtig erscheinen, dass die alte vollkommen in Vergessenheit gerät oder die Mitarbeiter sie zumindest auf unbestimmte Zeit verschieben. Unter diesen Voraussetzungen jonglierten die Testpersonen durchschnittlich mit zwölf verschiedenen Projekten gleichzeitig, die sie in ihrem zerstückelten Arbeitsalltag zu erledigen hatten.
Eine Führungskraft in einem Konzern bekommt heute zwischen 150 und 200 E-Mails am Tag - Spam nicht mitgerechnet. Um das seriös durchzuarbeiten, braucht sie mindestens zwei Stunden.
Eine der Ursachen findet sich in dem modischen Brauch, jeden Kollegen, Mitarbeiter oder Kunden auf jeden denkbaren E-Mail-Verteiler zu setzen. Als man Informationen noch kopieren und dann per Hauspost verteilen musste, wurde automatisch genau überlegt, wer denn die Information wirklich braucht. Heute ist es ein Klick des Absenders, und die ganze Firma wird zugeschüttet...
Denn der gerade der inflationäre „CC“-Gebrauch sorgt dafür, dass Informationen oft auch diejenigen nicht mehr erreichen, für die sie tatsächlich relevant sind. Denn die ertrinken gerade in den für sie unnötigen hunderten "Zur Info"-Mails.
Mehr Kommunikation bedeutet leider auch mehr Aufgaben aufgeladen zu bekommen, die noch dazu schnell erledigt werden sollen. Den Rationalisierungsmaßnahmen sind unter anderem die Einsparung von Sekretariaten mit sich gebracht. Dadurch sind bei wachsender Informationsflut sind die menschlichen Filter weggefallen, die früher für Führungskräfte Informationen vorsortiert haben.
Es ist also hoch an der Zeit, sich geschützt Räume und Zeiten zu schaffen.
Eine Maßnahme kann sein, die geschäftliche Kommunikation von der Bring- wieder zur Holschuld zu machen. Konkret sollen Informationen lieber systematisch und gut auffindbar im Intranet oder in internen Datenbanken abgelegt werden als in den elektronischen Rundlauf zu gehen.
Eine andere Maßnahme ist es, die Absender zu erziehen, nicht mehr alles auf „cc“ zu setzen. „Killt cc“ raten manche Unternehmensberater.
Wie man mit der elektronischen Kommunikation sinnvoll umgeht, dafür gibt es bisher keine wirklichen Spielregeln. Ein Versuch eines Unternehmen läuft daraus hinauf, die E-Mail-Kommunikation stark zu hierarchisieren. Mails sollen nur noch an den jeweils direkten Vorgesetzten geschickt werden können, aber nicht mehr weiter hinauf.
Andere Betriebsberater empfehlen, die e-mails nur noch zweimal am Tag zu bearbeiten. Und ein deutscher Uni-Professor hat sich eine andere Methode zulegt, um Fehler durch die geforderte Schnelligkeit zu minimieren: Er beantwortete alle Anfragen, die größere Budgetposten betreffen, erst einen Tag später, um wenigstens eine Nacht darüber schlafen zu können.
Manfred Hluma
hlumamanfred - 18. Nov, 12:44