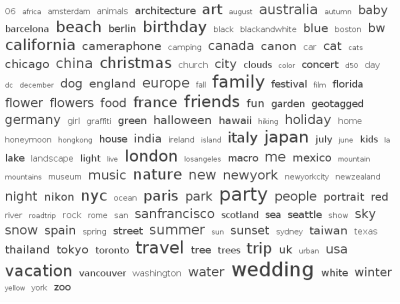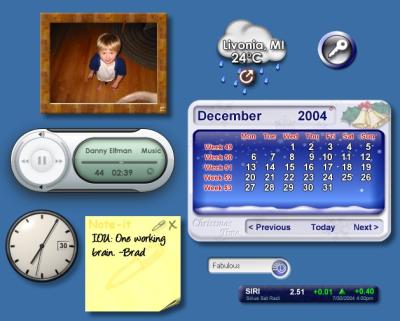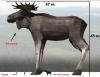"Exhumiert Falco" oder "Wie man von Toten profitiert"
Speziell den Wienern wird ja eine gewisse Verbundenheit zum Tod nachgesagt. Eine "Schöne Leich" gilt als Attribut für ein - wie auch immer - gelungenes Begräbnis und wer einigermaßen prominent ist, wird zur letzten Ruhestätte in einem Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof gebettet. Und auch die Kapuzinergruft zieht Touristen an.
Doch unsere südlichen Nachbarn zeigen vor, wie man einen Kult um einen prominenten Toten perfekt kommerzialisieren kann. Ehrwürdige Verstorbene des Kaiserhaus schön und gut, aber der - gesteuerte - Auftrieb um den italienischen Heiligen Padre Pio erreicht fast schon unchristliche Ausmaße.
Der Franziskanermönch Padre Pio, der von 1887 bis 1968 gelebt hat, und neben dem heiligen Franziskus der am meisten verehrte Heilige in Italien ist, zieht die Massen mehr als zu Lebzeiten an. Seit 1918 zeigten sich bei ihm angeblich die Wundmale Christi, später war er auch als Krankenheiler und Prophet tätig. 1999 wurde er von Johannes Paul II. selig, 2002 dann heilig gesprochen. Er gilt als einer der populärsten Heiligen Süditaliens.
Das kleine Dorf im Hinterland Apuliens auf der Halbinsel Gargano, in dem der Mönch gelebt und angeblich Wunder gewirkt hatte, ist längst einer der größten Wallfahrtsorte Europas. In der 27.000-Einwohner-Gemeinde gibt es 194 Hotels, 132 Bars, 110 Restaurants und Dutzende Großraumparkplätze. An jedem Wochenende kommen bis zu 500 Autobusse nach San Giovanni.
Nun wurde anlässlich des bevorstehenden 40. Jahrestages seines Todes der Leichnam Anfang März exhumiert – nicht zuletzt weil die Wunder Pios umstritten sind. Die Exhumierung der sterblichen Überreste des Franziskaner-Mönchs wurde in Anwesenheit einer Kommission aus mehreren Ärzten, einem vatikanischen Experten und einer Nichte des Heiligen durchgeführt.
Ab 24. April soll die Leiche dann öffentlich ausgestellt werden. Bis dahin wird der Leichnam in einer Krypta der Kirche Santa Maria delle Grazie aufbewahrt. "Einige Teile des Leichnams wie die Füße sind intakt", sagte Erzbischof Domenico Umberto d'Ambrosio. "Wir hoffen, dass auch der Papst zum Leichnam von Padre Pio pilgern wird", sagte der Erzbischof - es geht ja nichts über Marketing.
Am 23. September, dem Jahrestag seines Todes, soll dann das Grab des 2002 heiliggesprochenen Padre Pio in eine neue Kirche überführt werden, die vom Stararchitekten Renzo Piano in der süditalienischen Ortschaft San Giovanni Rotondo - 40 km nordöstlich von Foggia - erbaut wurde. Ein noch größerer Besucheransturm ist programmiert.
Bleibt zu überlegen, ob man in Österreich ähnliches tun kann. Doch auch bei längerem Nachdenken kommt man fast nur auf ein Möglichkeit: Exhumiert Falco! Viel mehr – attraktive - Heilige haben wir nicht.
Manfred Hluma
Doch unsere südlichen Nachbarn zeigen vor, wie man einen Kult um einen prominenten Toten perfekt kommerzialisieren kann. Ehrwürdige Verstorbene des Kaiserhaus schön und gut, aber der - gesteuerte - Auftrieb um den italienischen Heiligen Padre Pio erreicht fast schon unchristliche Ausmaße.
Der Franziskanermönch Padre Pio, der von 1887 bis 1968 gelebt hat, und neben dem heiligen Franziskus der am meisten verehrte Heilige in Italien ist, zieht die Massen mehr als zu Lebzeiten an. Seit 1918 zeigten sich bei ihm angeblich die Wundmale Christi, später war er auch als Krankenheiler und Prophet tätig. 1999 wurde er von Johannes Paul II. selig, 2002 dann heilig gesprochen. Er gilt als einer der populärsten Heiligen Süditaliens.
Das kleine Dorf im Hinterland Apuliens auf der Halbinsel Gargano, in dem der Mönch gelebt und angeblich Wunder gewirkt hatte, ist längst einer der größten Wallfahrtsorte Europas. In der 27.000-Einwohner-Gemeinde gibt es 194 Hotels, 132 Bars, 110 Restaurants und Dutzende Großraumparkplätze. An jedem Wochenende kommen bis zu 500 Autobusse nach San Giovanni.
Nun wurde anlässlich des bevorstehenden 40. Jahrestages seines Todes der Leichnam Anfang März exhumiert – nicht zuletzt weil die Wunder Pios umstritten sind. Die Exhumierung der sterblichen Überreste des Franziskaner-Mönchs wurde in Anwesenheit einer Kommission aus mehreren Ärzten, einem vatikanischen Experten und einer Nichte des Heiligen durchgeführt.
Ab 24. April soll die Leiche dann öffentlich ausgestellt werden. Bis dahin wird der Leichnam in einer Krypta der Kirche Santa Maria delle Grazie aufbewahrt. "Einige Teile des Leichnams wie die Füße sind intakt", sagte Erzbischof Domenico Umberto d'Ambrosio. "Wir hoffen, dass auch der Papst zum Leichnam von Padre Pio pilgern wird", sagte der Erzbischof - es geht ja nichts über Marketing.
Am 23. September, dem Jahrestag seines Todes, soll dann das Grab des 2002 heiliggesprochenen Padre Pio in eine neue Kirche überführt werden, die vom Stararchitekten Renzo Piano in der süditalienischen Ortschaft San Giovanni Rotondo - 40 km nordöstlich von Foggia - erbaut wurde. Ein noch größerer Besucheransturm ist programmiert.
Bleibt zu überlegen, ob man in Österreich ähnliches tun kann. Doch auch bei längerem Nachdenken kommt man fast nur auf ein Möglichkeit: Exhumiert Falco! Viel mehr – attraktive - Heilige haben wir nicht.
Manfred Hluma
hlumamanfred - 11. Mär, 23:49